Immer mehr Friedhöfe im Cuxland sind mit Schotter bedeckt. Oder mit Stein- und Marmorplatten. Heinz-Wilhelm Schnut, Ortsheimatpfleger in Langen, hat mit seiner Ehefrau Uschi lange auf die weißen Steine gesetzt, um das Familiengrab zu gestalten. „Auch für uns war das zunächst eine gute Lösung, weil wir nicht jeden Tag auf den Friedhof konnten, um das Grab der Eltern und Großeltern auf Vordermann zu bringen.“ Und jünger werde man schließlich auch nicht, sagt Schnut, mittlerweile 74 Jahre alt.
Die kleinen weißen Steine haben Moos angesetzt
Bald haben er und seine Frau festgestellt, dass sich die kleinen weißen Steine verfärben. „Sie haben Moos angesetzt, und Unkraut wuchs auch zwischen ihnen hervor“, erinnert sich Schnut.
Anfangs habe man sich noch die Mühe gemacht, die Steine auf dem Friedhof in regelmäßigen Abständen gründlich zu waschen, „damit sie wieder schön weiß sind“. Aber das sei eine überaus zeitaufwendige Arbeit gewesen. „Und deshalb haben wir uns vor drei oder vier Jahren dazu entschlossen, diese Steine wieder herunterzunehmen und Pflanzen zu setzen“, erzählt der Langener.
Heute wachsen Buchsbäume und Zwerg-Azaleen auf dem Familiengrab. Im Frühjahr wolle man noch Eisbegonien pflanzen. „Es sieht einfach schöner aus“, sagt Schnut, und einmal pro Woche habe man sich vorgenommen, die Sträucher zu pflegen und Unkraut zu entfernen.
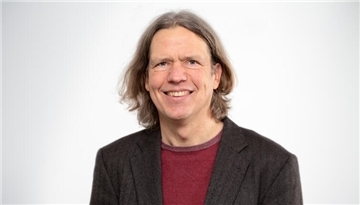

Die Herstellung eines Schottergrabes schädigt nicht nur die Artenvielfalt, sondern auch unmittelbar das Klima.
Generell hält der Bund für Natur und Umweltschutz (BUND) Schottergräber für nicht empfehlenswert. „Sie verfügen über keinerlei ökologische Funktionen hinsichtlich Pflanzenvielfalt und Leben im Boden.“ Außerdem bieten sie keine Ökosystemdienstleistungen an, produzieren also keinen Sauerstoff oder filtern keine Schadstoffe aus der Luft“, erklärt Regionalgeschäftsführer Bernd Quellmalz.
Zwar haben auch herkömmliche Grabstellen mit häufigen Bepflanzungen nur einen geringen ökologischen Wert. „Von den stark blühenden Zuchtsorten einer Wechselbepflanzung profitieren keine Wildbienen oder Schmetterlinge“, erklärt der BUND-Experte, „zudem werden hier vielfach Torf und Pestizide in der Anzucht verwendet, so dass unmittelbar erhebliche negative Umweltwirkungen entstehen.“ Aber der Schotter ist neben seiner Lebensfeindlichkeit ein echter Klimakiller.
„Ein Schottergarten wird unter hohem Energieaufwand hergestellt“, weiß Quellmalz, „und das Material wird oftmals über weite Strecken herangeschafft.“ Der Abbau und das Zermahlen von Steinen seien ebenso energieintensiv wie der Transport. Auch das Vlies unter dem Schottergarten verbrauche bei der Herstellung Energie und Erdöl. Die Reinigung, sei es nun mit Hilfe von Hochdruckreinigern oder Laubbläsern, verbrauche zusätzliche Energie. Quellmalz: „Die Herstellung eines Schottergrabs schädigt nicht nur die Artenvielfalt, sondern auch unmittelbar das Klima.“
Trend zu pflegeleichten Grabfeldern durchaus nachvollziehbar
Es sei durchaus nachvollziehbar, dass der Trend zu pflegeleichten Grabfeldern zunimmt, räumt der BUND-Experte mit Blick auf den gesellschaftlichen Wandel ein. Allerdings sei es ein Trugschluss, dies gerade mit Schotter versiegelten Flächen erreichen zu wollen. „Je kleiner Schotterflächen sind, desto schneller sammelt sich hier Humus an, in dem dann die unerwünschten ,Unkräuter‘ gedeihen“, erklärt der Naturschützer weiter.
Der Pflegeaufwand, diese im Kies zu entfernen, sei dann umso größer. Quellmalz wirbt dafür, „stattdessen Grabstellen naturnah zu gestalten“. Zwar seien Grabstellen in der Regel nur klein und es böten sich nicht so viele Möglichkeiten an wie in einem privaten Garten, „aber auch schon auf kleinen Flächen lässt sich viel für die Artenvielfalt erreichen“.

Dieses Grab auf einem Friedhof im Cuxland sieht besonders „naturnah“ aus. Dabei handelt es sich jedoch weniger um das Ergebnis bewusster Gestaltung. Vielmehr scheint der Angehörige zu fehlen, der sich der regelmäßigen Pflege dieser Grabstelle annehmen kann. Foto: Schoener
Beispielsweise hat der BUND in seinem landesweiten Projekt „Ökologische Nische Friedhof“ Doppelgrabfelder mit heimischen, wildbienenfreundlichen Pflanzen bepflanzt. An Natternkopf, Färberhundskamille und Rundblättriger Glockenblume haben Experten schließlich an einem einzigen Tag elf verschiedene Wildbienenarten gefunden. „Davon sind sechs auf bestimmte Pflanzen spezialisiert und eine vom Aussterben bedrohte Art.“
Noch einige andere Tipps auf Lager
Quellmalz hat weitere Tipps auf Lager: „Um eine Grabstelle pflegeleichter zu halten, kann eine Mulchschicht unerwünschten Aufwuchs verringern und zudem Feuchtigkeit zurückhalten.“ Trockenheitstolerante Wildstauden und ein wenig Immergrün als Dauerbepflanzung statt schnell verwelkender Zuchtsorten sorgten darüber hinaus für kleine ökologische Nischen.
Bei der Verwendung von Blumenerden und Düngern sei zu beachten, dass diese den Boden nicht nur für anspruchsvolle Sorten, sondern eben auch für sogenannte Unkräuter verbessern. Diese lieben nährstoffreiche Erden. Auf mageren Erden mit wenig Nährstoffen können sie kaum wachsen, betont Quellmalz und hofft auf viele Nachahmer.









